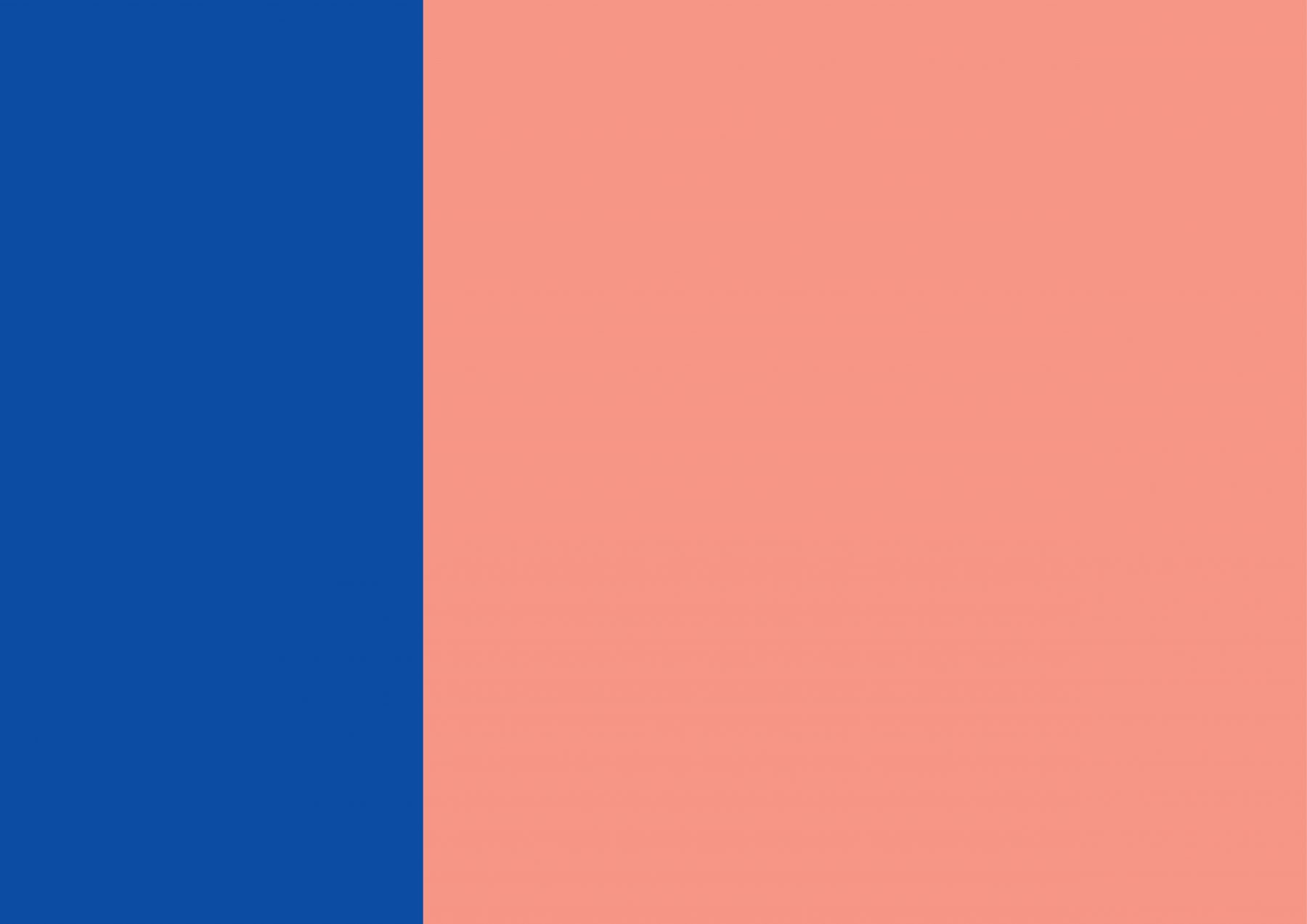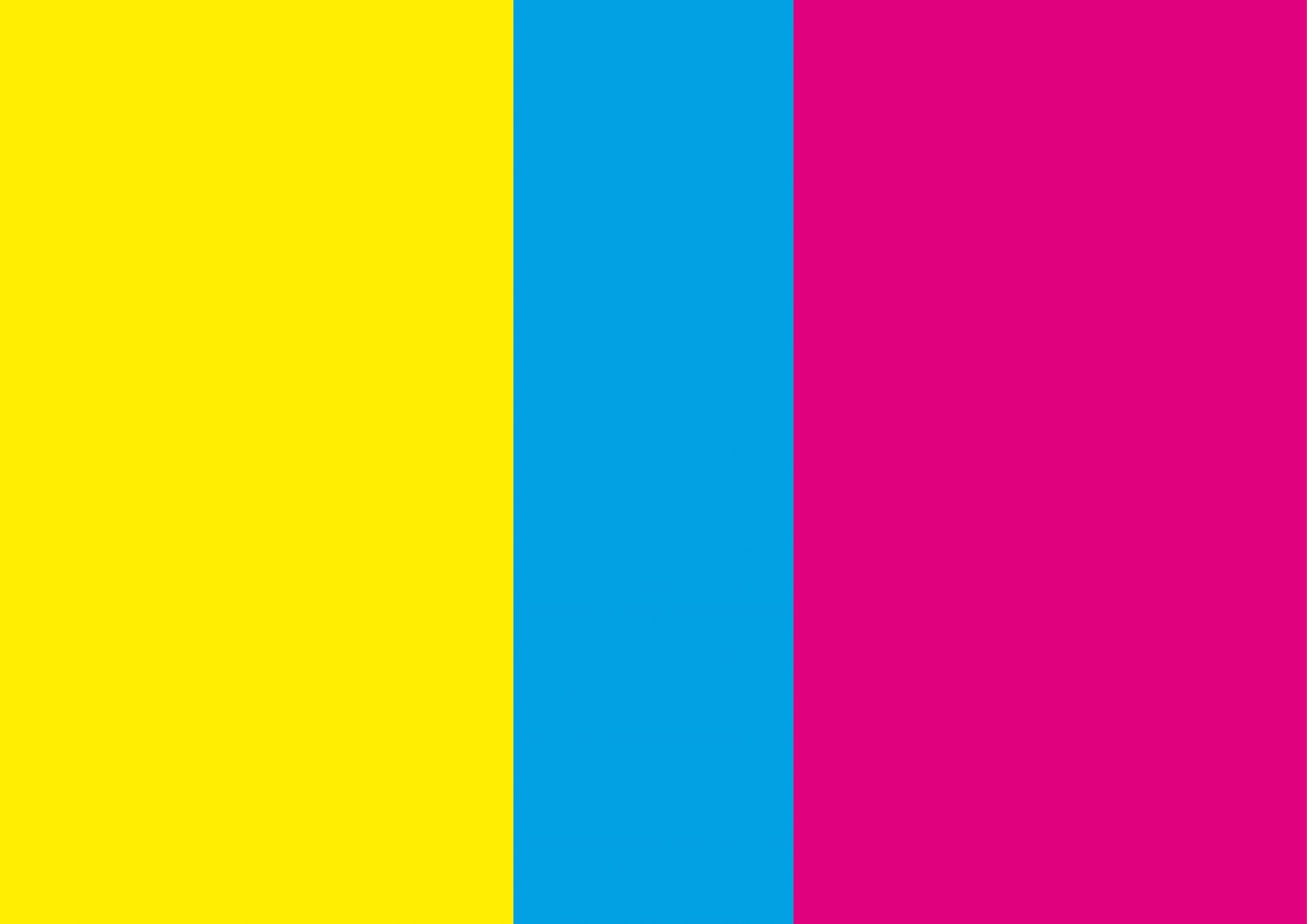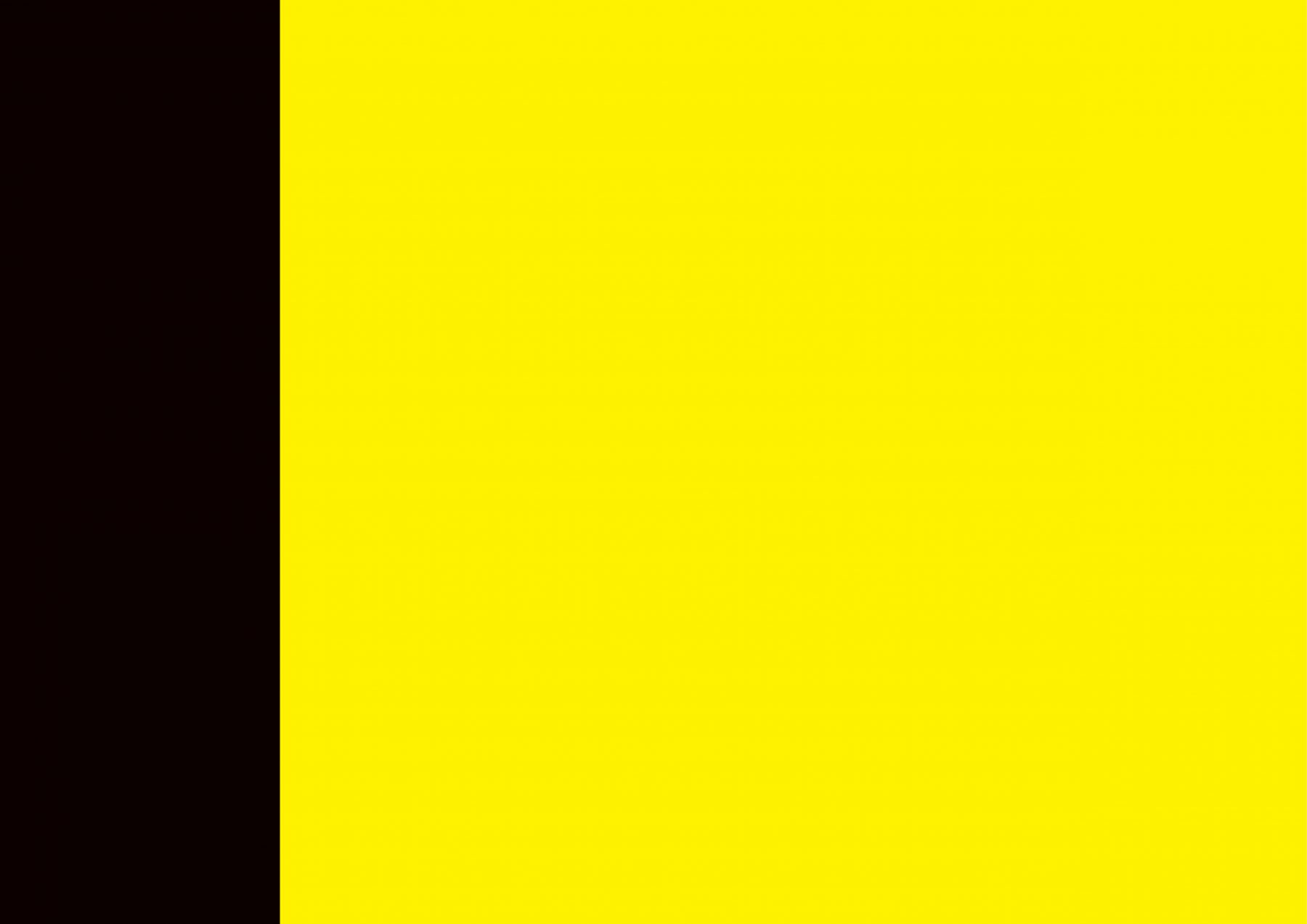Schön und Blöd
Notes on Branding
Gestalter kennen das. Ein ausgefeilter Entwurf, tagelang durchdacht und erarbeitet, wird durch eine ominöse Ehefrau oder Ehemann in nur einer Nacht zunichte gemacht. Dabei hatte der Kunde gerade gestern noch gemeint, er wolle nur noch mal darüber schlafen, bevor er uns eine Freigabe erteilt. Was ist da nur passiert?
Wer um Kritik bittet, bekommt sie auch. Egal, ob es sich um den Lebenspartner oder die versammelte Hintermannschaft handelt, niemand enttäuscht gerne und hat nichts beizusteuern.
Was nun folgt ist das Ausfeilen sämtlicher Ecken und Kanten eines Designs / eines Texts / einer Marke, an denen man sich stoßen könnte. Über bleibt ein glatt geschliffener, formloser Kompromiss, der kleinste gemeinsame Nenner. Und der sieht in Bildern gerne schonmal so aus: Ein süßes Mädchen sitzt unter einem Baum und isst einen Apfel. Fertig ist das Sujet für Nachhaltigkeit.
Versteh mich nicht falsch: Demokratie ist etwas Schönes. Doch gerade bei Marken ist sie kontraproduktiv. Denn es ist ein Irrglaube, dass ein Bild möglichst vielen gefallen muss, um zu funktionieren. Im Gegenteil führt das Abgleichen mit unterschiedlichen Geschmäckern nur zu einem austauschbaren und damit nicht differenzierbaren Ergebnis. Demhingegen leben Marken von zwei zentralen Kriterien: Persönlichkeit und Markanz.
Schön und blöd
Die lt. Eva Heller beliebtesten Farben sind gleichzeitig jene, die sich in Corporate Designs weltweit am häufigsten wiederfinden. Die Ursache ist aber nicht in der Orientierung an strategischen Überlegungen zu finden, sondern im Geschmack des Managements. Bezeichnenderweise sind es daher gerade die vermeintlichen Exoten wie das Magenta von T-Mobile, das Lila von Milka, das Türkis von Siemens oder das Altrosa von Manner, die in ihrer Branche hervorstechen – und das abseits vom allgemeinen Geschmack.
Die Bildsprache vieler Marken bildet leider keine Ausnahme. Das gesellschaftliche Ideal von Frauen klammert den Makel etwa aus und erhebt die Symmetrie zur Prämisse. Um für ihre Kunden attraktiv zu wirken, bedienen sich Unternehmen eines plumpen visuellen Codes: Die Gesichter sind ebenmäßig, schön und attraktiv, aber auch austauschbar, oberflächlich und erschreckend unecht.
„Schön und Blöd“ sagte einmal der Schweizer Grafiker Martin Woodtli, mit dem ich im Rahmen einer Studienarbeit sprechen durfte. Er meinte damit die starke Tendenz in Grafik und Werbung zur immer gleichen Symbolik und Formensprache. Das geflügelte Wort steht für mich sinnbildlich für eine Unsitte in der visuellen Kommunikation:
Sie schafft nicht nur Austauschbarkeit, sondern mit ihrer Inszenierung eine regelrechte Kluft zur Realität, die einer Identifikation mit einer Idee oder Marke im Wege steht.
Das ist nicht mehr zeitgemäß: Denn Konsumenten sind die dauerhafte Berieselung mit Idealbildern gewohnt, nehmen das Falsche als störend wahr oder blenden es komplett aus.
Wer allen gefallen will, gefällt schlussendlich niemandem.
Authentizität lautet daher das Stichwort. Es gilt, Identität sichtbar zu machen, um Identifikation zu ermöglichen. Das Schöne daran: Die Identität von Unternehmen ist immer einzigartig. Damit ist die perfekte Voraussetzung für Markanz eigentlich bereits vorhanden – sie muss lediglich in den Vordergrund gearbeitet werden.
Attraktivität misst sich nicht an einer schönen Fassade, sondern an der Sichtbarkeit und Zugfähigkeit dessen, was Unternehmen und Produkte einzigartig macht.
Nach dem Prinzip “Form follows Function” ist Branding keine Oberflächenbegrünung. Stattdessen schafft es mit seinen Stilmitteln bewusst Differenzierung zum Mitbewerb. Das erfordert den Mut, sich selbst zu sein – und damit eben anders als andere. Marke braucht Ecken und Kanten. Wer das nicht möchte, kommuniziert beliebig. Oder geht in Schönheit unter.